Kategorie: Politik
Bundestagswahlen ’21: Vorstellung der 6 wichtigsten Parteien
“Antirassismus geht uns alle an”| Interview mit Filiz Polat

Filiz Polat – Mitglied des Bundestags
Filiz Polat ist Abgeordnete des Deutschen Bundestags für die Partei Bündnis 90/Die Grünen. Sie kommt aus Niedersachsen und vertritt ihre Fraktion im Bundestagsausschuss für Inneres und Heimat und stellvertretend im Ausschuss für Menschenrechte. Sie ist studierte Volkswirtin und Sprecherin der grünen Fraktion für Migration und Integration.
qurt.news: Was schlagen Sie vor, um Antirassismus in Schule und Alltag prominenter zu machen?
Filiz Polat: Antirassismus geht uns alle an, trifft aber nicht jeden gleichermaßen. Es ist ganz wichtig, dass das jede und jeder von uns als Leitsatz verinnerlicht und das wir uns alle unserer Privilegien bewusst sind. Das gilt, gerade wenn wir nicht zu einer Minderheit gehören die von Rassismus, Antisemitismus oder Antiziganismus betroffen ist. Zu einer konsequenten antirassistischen Politik gehört einerseits, Menschen, die diskriminiert werden, zu schützen. Das ist Aufgabe des Staates und der Zivilgesellschaft. Auf der anderen Seite bedeutet es, zu erkennen, dass Rassismus in unserer Gesellschaft schon lange tief verwurzelt ist und es dadurch für viele Menschen Benachteiligungen gibt, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Ein Beispiel: über Jahrzehnte wurden Männer, die Männer geliebt haben, oder Frauen, die Frauen geliebt haben, strafrechtlich verfolgt. In Deutschland war das bis weit ins 20. Jahrhundert hinein so und das hat natürlich zu Nachteilen geführt, auch am Arbeitsmarkt.. Es gibt einfach strukturelle Benachteiligungen und die gilt es auszugleichen. Das bedeutet Platz zu machen, damit die Vielfalt in unserer Gesellschaft auch in den Führungsetagen sichtbar wird. Ein ganz wichtiger Baustein ist die Schule. Hier gilt es das alles zu thematisieren und vor allem mehr über Rassismus und die dahinter stehenden Strukturen zu lernen. Ein Beispiel ist der Kolonialismus, der bis heute wirkt. Gleichzeitig geht es darum, Vielfalt sichtbar zu machen. Unsere Schulbücher sind doch sehr weiß und zeigen nicht die Realität, wie unsere Schülerschaft zusammengesetzt ist oder wie bunt mittlerweile Familien sind.
qurt.news: Frau Polat, wir führen in Deutschland ja nicht zum ersten Mal eine öffentliche Debatte über Rassismus in der Gesellschaft. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Qualität dieser Debatte verändert?
Filiz Polat: Das ist nicht ganz eindeutig zu beantworten. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist doch eine andere Qualität, weil wir jetzt wirklich auch über Rassismus reden und nicht nur über Rechtsextremismus. Früher lag der Fokus sehr stark auf Rechtsextremismus und damit einhergehender Gewalt. Heute sprechen wir auch durch die Black-Lives-Matter-Bewegung mehr über das Thema Rassismus, was Rassismus heißt, in all seinen Facetten und wie dieser in unseren Institutionen und unserer Gesellschaft strukturell verankert ist. Viele Menschen fangen an sich dabei selbst zu reflektieren und über ihre Privilegien nachzudenken. Natürlich nicht alle, denn wenn ich selbst von Rassismus nicht betroffen bin und es mir gut geht, zumindest was das Thema anbetrifft, warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Das ist erstmal der bequemere Weg, doch mittlerweile fängt zumindest ein großer Teil der Bevölkerung an, darüber nachzudenken: Wie geht es Menschen in Deutschland, wenn sie von Rassismus betroffen sind? Und was hat das mit mir zu tun? Ich glaube diese Qualität ist schon anders. Andererseits haben wir, auch durch die rechtsextreme Partei, die mittlerweile in den Parlamenten in Bund und Land sitzt, sehr krasse Debatten. Sie werden sehr emotional, sehr populistisch und mit Worten geführt, die versuchen nationalsozialistische Sprache wieder hoffähig zu machen. Damit wird die Debatte insofern vergiftet, dass vermeintlich die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, wenn man bestimmte Wörter heute nicht benutzen sollte, wie zum Beispiel das N-Wort. Dieser Rechtspopulismus ist rassistisch und eine Gefahr für unsere Demokratie und unser Zusammenleben.
(…)
qurt.news: Es wird ja im politischen Diskurs grade wieder viel über Rassismus und Fremdenhass gesprochen. Wie kriegt man die Politik dazu, dass dort besprochene auch wirklich umzusetzen?
Filiz Polat: Wir haben jetzt auf Bundesebene gerade nach den Anschlägen in Halle und Hanau insofern Bewegung in die politische Auseinandersetzung bekommen, als das auf Druck der Zivilgesellschaft ein sogenannter Kabinettsausschuss eingerichtet wurde, wo sich verschiedene Ministerinnen und Minister zusammengesetzt haben, um ein Maßnahmenpaket gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu erarbeiten. Das ist im November verabschiedet worden und wird jetzt gerade umgesetzt. Meine Hauptkritik an diesem Maßnahmenpaket ist, dass die Bundesregierung nicht selbst reflektiert, wo in den eigenen Strukturen Rassismus zu bekämpfen ist. Eine wichtige Forderung von Menschen, die Diskriminierung erfahren, ist zuzugeben, dass auch der Staat diskriminiert. Schwarze Menschen berichten vom sogenannten racial profiling. Wenn man Schwarze Menschen in Deutschland trifft, sagen sie: „Es gibt keine Woche, wo ich nicht einmal am Bahnhof von der Polizei kontrolliert werde“. Jede*r, der*die nicht schwarz ist, kann hingegen an einer Hand abzählen, wie oft er*sie in einem Jahr anlasslos von der Polizei kontrolliert wird. Es muss den Staat interessieren, die entsprechenden Ursachen zu eruieren. Das ist ja kein Zufall, was steckt dahinter? Und dem verweigert sich die Bundesregierung auch mit diesem Maßnahmenpaket. Was mir besonders wichtig ist: Wir haben ja einen Diskriminierungsschutz in Deutschland, verankert im Grundgesetz in Artikel 3. Ausdruck findet dieser im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Wenn ich diskriminiert werde, dann kann ich das zivilrechtlich geltend machen. Dieses Antidiskriminierungsgesetz ist bis heute viel zu schwach, weil es zum Beispiel staatliche Diskriminierung nicht beinhaltet. Das müsste man dringend ändern, auch aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen Deutschlands. Dem ist aber die Bundesregierung genauso wenig nachgekommen, das heißt überall, wo es um wirklich wichtige gesetzliche Maßnahmen für einen stärkeren Diskriminierungsschutz geht, bleibt die Bundesregierung tatenlos. Immerhin macht sie jetzt einen großen Schritt in Richtung Forschung. Wir haben sehr wenig Daten darüber, wie Rassismus wirkt und wie er historisch bedingt ist. Da investiert die Bundesregierung ein wenig Geld, um hier die Datenlage zu verbessern. Das ist gut.
(…)
qurt.news: Angesichts des wieder aufflammenden Konflikts im Nahen Osten kam es in den vergangenen Wochen zu antisemitischen Aussagen und Taten im Rahmen pro-palästinischer Demonstrationen. Was kann die Politik und was können wir als Schüler*innen machen, um dem entgegenzuwirken?
Filiz Polat: Der Antisemitismus in Deutschland hat viele Gesichter. Er drückt sich in verschiedenen Formen aus, ganz wichtig ist, dass man sich als Schüler*in mit Antisemitismus und den Formen von Antisemitismus auseinandersetzt. Natürlich auch wenn es darum geht, die außenpolitische Dimension, hier den Nahostkonflikt, im Unterricht zu thematisieren. Es ist wichtig, dass man die Mechanismen lernt und den Unterschied erkennt zwischen Israel-Kritik und ganz klassischem Antisemitismus. Wenn zum Beispiel die doppelte-Schuld-Frage eine Rolle spielt, also das “das was den Juden angetan wurde, jetzt die Juden mit den Palästinensern antun”, dann ist das Antisemitismus. Es ist wichtig, dass man das Schüler*innen aber auch Erwachsenen beibringt. Gerade wenn man in der Schülerschaft junge Menschen hat, die neu zugewandert sind aus einem Land, in dem ein ganz anderer historischer Hintergrund das Gespräch über die Shoah (Holocaust) bestimmt. Es wichtig, die verschiedenen Perspektiven einfließen zu lassen und auch vielleicht mal forsch zu diskutieren. Erklärungen helfen bei der Einordnung und wenn folglich antisemitische Sätze fallen, müssen diese ganz klar verurteilt werden.
(…)
qurt.news: Haben Sie konkrete Tipps, wie wir als überwiegend weiße Jugendliche bessere Verbündete im Kampf gegen Rassismus werden können?
Filiz Polat: Im Grunde geht es darum, Allianzen zu bilden. Rassismus und Sexismus sind oft zwei Seiten einer Medaille. Wenn man Feministin ist, dann ist es wichtig, dass Männer sich selbst reflektieren und an der Seite von Frauen stehen. Das kann man zum Beispiel bei den Debatten, dass Frauen abends oftmals Angst haben, alleine nach Hause zu gehen. Ein erster Schritt wäre, dass Männer sich mal Gedanken machen sollen, warum das so ist. Und sich auch mit Frauen darüber austauschen, was das bedeutet, mit diesem Grundgefühl aufzuwachsen und das schon als selbstverständlich anzusehen. Deswegen ist es wichtig zu schauen, dass man überall, wo es um Diskriminierung geht, Allianzen schmiedet und im Gespräch bleibt. Das gilt gerade für die Menschen, die in dem Fall nicht von dieser Diskriminierung betroffen sind. Ich persönlich setze mich jetzt zum Beispiel sehr intensiv mit Inklusion von Menschen mit Behinderung auseinander. Was kann ich tun, um inklusiver zu denken und zu handeln? Man kann sich nicht ständig damit beschäftigen, aber man kann sich das für sich selbst vornehmen oder eben gemeinsam mit Freund*innen Verbündete suchen. Und das in seinem eigenen Umfeld oder an der eigenen Schule thematisieren. Es ist für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, bestärkend, wenn nicht nur sie selbst die Themen ansprechen. Wenn ich jetzt als eine Frau mit türkischen Wurzeln in der Klasse angefeindet werde, möchte ich das nicht thematisieren müssen, sondern ich freue mich, wenn das meine Klassenkameradin anspricht.
qurt.news: Wie können junge Menschen politisch aktiv werden? Wie kann man auch wirklich was erreichen? Das Wahlrecht bekommen wir ja erst ab 18 und jugendpolitische Bewegungen wie „Fridays for Future“ werden meist belächelt.
Filiz Polat: Ich bin natürlich auch für die Absenkung des Wahlalters. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das wirkungslos ist, was diese Generation schon erreicht hat. Ich selber habe ja auch angefangen politisch aktiv zu werden, noch bevor ich volljährig geworden bin. Mich hat motiviert, zu sehen, dass das, was ich angesprochen habe gehört wird und umgesetzt wird. Manchmal dauert es zwar länger und manchmal ist es wirklich ein Bohren dicker Bretter. Gerade als junger Mensch ist man oft ungeduldig, man will schnell was erreichen und das ist auch gut so. Und wenn man sich zusammenschließt, kann man auch richtig was erreichen, Greta Thunberg ist hierfür nur eines von vielen Beispielen. Wichtig ist, sich ein konkretes Projekt vorzunehmen. Nehmen wir das von mir angesprochene Beispiel Schule und Menschen mit Behinderung. Wie kann eine Schule inklusiv aussehen? Was sind die wichtigsten Sachen, die man vielleicht sogar ganz schnell umsetzen kann und was dauert vielleicht etwas länger? Oder eben beim Thema Rassismus. Da kann man sich eine Woche auszusuchen und eine Projektwoche veranstalten und dann dieses Thema auch mit Menschen von außen bearbeiten. Schule soll ja auch ein Raum sein, der offen ist und Reflektion von außen einholt. Spannend wäre auch, ein Schulbuch komplett umzugestalten. Wie kann eigentlich ein Schulbuch im 21. Jahrhundert aussehen? Wie kann es die Gesellschaft in seiner Realität der spiegeln? Jede*r kann was dazu beitragen, jede*r kann aktiv werden.
qurt.news: Was machen die Grünen, um Diskriminierung jeder Art in der Gesellschaft einzuschränken? Gibt es konkrete Ziele?
Filiz Polat: Wir haben drei zentrale Säulen, wie wir auf strukturellen Rassismus strukturelle Antworten geben. Wir wollen ein scharfes Schwert im Kampf gegen Diskriminierung und deswegen fordern wir ein Bundesantidiskriminierungsgesetz, was keine Ausnahmetatbestände, wie im aktuellen Gesetz vorgesehen, zulässt. Zum anderen ist es beim Diskriminierungsschutz im Moment so, dass man nur gegen private Diskriminierung vorgehen kann, aber nicht, wenn der Staat, also Behörden, diskriminierend handeln. Das ist eine der wesentlichen Änderungen, die wir fordern. Wichtig dabei ist auch, dass man in ganz Deutschland ein Netzwerk von Beratungsstellen hat. Die meisten Menschen wissen nicht, wann sie und wie sie Antidiskriminierung geltend machen können, deshalb sind Ansprechpartner*innen vor Ort besonders wichtig. Damit kommen wir schon zur Zivilgesellschaft. Sie ist ein ganz, ganz wichtiger Partner für den Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus, aber auch für großflächige politische Bildung. Um die Zivilgesellschaft zu stärken, fordern wir ein Demokratiefördergesetz, das heißt, dass man sich nicht von einem Jahr zum nächsten um Projektgelder bewerben muss und sich von Projekt zu Projekt hangelt, sondern dass man wirklich strukturell gefördert wird und verlässliche Strukturen schafft. Der dritte große Baustein sind Repräsentation und Teilhabe. Dafür wollen wir erstmalig ein Gesetz auf den Weg bringen, welches positive Fördermaßnahmen für Menschen, die strukturell benachteiligt werden, ermöglicht. Denn eine chancengerechte Gesellschaft gestalten wir nur, wenn alle gleichberechtigt am Tisch sitzen können.
qurt.news: Vielen Dank.
Das Gespräch führte Paula Moritz.
Heile Welt?
Ein Jahr nach der Ermordung George Floyds blicke ich zurück auf das was war und das was ist.
Es grassiert eine Krankheit. Eine Krankheit, die die ganze Welt in Atem hält. Corona ist präsent und hat mehr oder weniger starke Auswirkungen auf jeden von uns.
Doch es grassiert noch eine andere Krankheit und das schon über Jahrhunderte, eine Einstellung, die Menschen das Leben kostet. Es ist der Rassismus. Er ist genauso aktuell wie Corona und hat ebenfalls seine Opfer zu verzeichnen.
Vor einem Jahr (Mai 2020):
Ich sitze zu Hause, die Empfehlungen des social-distancing im Hinterkopf. Ich habe mir eine Blase erschaffen, die zunächst noch heil ist. Eine kleine heile Welt, hier bei mir zu Hause. Ich öffne Instagram und sehe, wie Sänger von zu Hause musizieren, Stars ihre Haustiere in die Linse halten oder meditieren, um sich selbst zu finden und wie Livestreams tausendfach geklickt werden. Ich sehe TikToks, Corona – Memes, Diskussionen über Schönheitsoperationen, Fan-Accounts, die für ihre liebsten Stars aufwendigste Edits posten, einen Oliver Pocher, der sich über „Influencer“ aufregt und mittendrin in dem Meer aus Videos, Fotos und Livestreams – ein Video.
Ein Video datiert auf den 25. Mai 2020. Ein Video, das einen US-Amerikanischen Polizisten in Minneapolis (USA) zeigt, der einen schwarzen, unbewaffneten Mann mit seinem Knie auf den Boden drückt. Das Knie des Polizisten ruht im Nacken des Mannes, der unter ihm keucht und nach Luft ringt. „Please, please I can’t breathe. My stomach hurts. My neck hurts. Everything hurts. They’re going to kill me“[Bitte, Bitte, ich kann nicht atmen. Mein Bauch tut weh. Mein Nacken tut weh. Alles tut weh. Sie werden mich töten]. Passanten versuchen mit den Polizisten zu diskutieren. Sie machen darauf aufmerksam, dass die Nase des Mannes blutet.
Der Polizist bewegt sich aber nicht von der Stelle, er scheint sich seinem Vorgehen sehr bewusst zu sein. „He can’t move. He stops breathing“ [Er kann sich nicht bewegen. Er hört auf zu Atmen]. Drei weitere Polizisten sehen zu und unternehmen nichts. Der schwarze Mann wimmert und wiederholt immer wieder: “I can’t breath, I can’t breath“ [Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen]. Einer der Passanten ruft „He is enyoing this“ und wirft damit dem Officer vor, er genieße es George Floyd die Luft abzuschneiden. Und immer noch stehen die Kollegen des Polizisten daneben und tun nichts. Irgendwann verliert der Mann das Bewusstsein.
Der Name des Mannes ist George Floyd, war George Floyd. Nachdem der Officer ihm ungefähr 8 Minuten die Luft abgedrückt hat, verliert er das Bewusstsein und erlangt es später auch nicht wieder. George Floyd ist tot.

Portrait George Floyds im Berliner Mauerpark (Creative Common)
Ich tauche tiefer ein und gehe auf den Hashtag #justiceforgeorgefloyd; es taucht ein weiteres Video auf. Zu sehen sind wütende Menschen, die vor dem Haus des Polizisten stehen. „Justice for George Floyd“ [Gerechtigkeit für George Floyd], wird gerufen. Die Frau hinter der Kamera läuft an einer Reihe von 75 Polizisten vorbei, die zum Schutz dieses einen Polizisten eine Mauer vor seinem Haus gebildet haben. Dabei sagt sie an den Zuschauer gerichtet: “Look how f****** many people are protecting this killers house“. Die Menschen sind wütend. Sie sind nicht mehr länger still. Sie machen ihrem Ärger Luft.
Ein weiteres Video taucht auf. Eine schwarze Frau, die mit wutverzehrtem Gesicht erklärt, dass sie es satt hat, friedlich zu sein. Sie hat zwei Brüder durch Polizeigewalt verloren. Ich klicke auf den nächsten Beitrag und sehe einen schwarzen Jungen, der über seine Verzweiflung singt. „I just want to live“, singt er. Ein anderer rappt über das Leben als schwarzer Mann in den USA. Und es geht endlos so weiter. Mitleidsbekundungen, wütende Ansprachen, Beiträge mit der Bildunterschrift „Black Lives Matter“, pragmatische Hinweise zum Unterzeichnen von Petitionen und immer so weiter.
Das Internet ist in Aufruhr. Je weiter ich scrolle, desto mehr verabschiedet sich die heile Welt der Blase, die ich mir aufgebaut habe. Die Realität hat das Ruder wieder in die Hand genommen.
Racism is not getting worse, it’s getting filmed –Will Smith
[Rassismus wird nicht schlimmer, es wird gefilmt]
Heute (Mai 2021):
Heute jährt sich der Todestag von George Floyd. Seit diesem Tag ist viel passiert. George Floyds Tod war der Auslöser weltweiter Massenproteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Dabei kam es sogar teilweise zu Ausschreitungen. Es war als würden die Menschen endlich wachgerüttelt und für ein Thema sensibilisiert werden, dass schon seit Jahrhunderten ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft darstellt.
Viele Menschen, die mit der Thematik Rassismus und Polizeigewalt wenig zu tun hatten, weil sie selbst davon nicht betroffen sind, waren gezwungen zuzuhören.

BLM-Protest in Paris, Juni 2020
(Thomas de Luze via Unsplash)
Das „Black Lives Matter“- Movement, welches ursprünglich im Jahr 2013 begann, bekam im Zuge dieses Vorfalls eine vorher noch nie so groß gewesene Aufmerksamkeit. Der Zuwachs war enorm. Es tauchten immer mehr Videos von ähnlichen Gewalttaten auf und immer mehr Menschen teilten ihre Erfahrungen, weil ihnen endlich zugehört wurde. Man sollte die Namen der Opfer nennen und nie vergessen. Das war eine der vielen Botschaften die, diese Menschen verbreiteten.
Aber was hat sich im Fall George Floyd getan und wie sieht es heute mit dem „Black Lives Matter“-Movement aus?
Im Fall George Floyd kam es nach hohem gesellschaftlichen und medialen Druck im April 2021 zu einem Schuldspruch des Ex-Polizisten Derek Chauvin (dem Mörder von George Floyd). Allgemein ist ein solches Urteil bei Fällen von Polizeigewalt aber leider eher selten. Das Strafmaß ist bis heute noch nicht bekannt und wird voraussichtlich am 16. Juni verkündet. Den drei ebenfalls anwesenden Polizisten soll 2022 wegen Beihilfe der Prozess gemacht werden.
Des Weiteren wurden die Angehörigen von George Floyd von dem neuen US- Präsident Joe Biden ins Oval Office eingeladen. Mit dieser Geste grenzt sich dieser klar von seinem Vorgänger Donald Trump ab. Außerdem wird zurzeit über ein nach George Floyd benanntes Polizeireform-Gesetzt in den USA verhandelt. Dieses Gesetz würde unter anderem eingeschränkte Immunität von Polizisten und eine nationale Datenbank für polizeiliches Fehlverhalten beinhalten. Für die endgültige Verabschiedung dieses Gesetzes werden aber sowohl Stimmen der Demokraten als auch der Republikaner benötigt.
Das „Black Lives Matter“- Movement hat zwar durch den Vorfall unglaublich viel Aufmerksamkeit, Anerkennung und Zuspruch erhalten. Trotzdem ist diese Aufmerksamkeit und „Wokeness“ mit der Zeit wieder weniger geworden. Dafür gibt es verschiedene Gründe.
Die meisten Menschen sind schon längst wieder in ihrem gewohnten Lebensablauf zurückgekehrt. Der damals herrschenden „Ausnahmezustand“ ist vorbei. Der „erste Schock“ wurde sozusagen „überwunden“. Es gibt keine Massenproteste mehr und andere politische Themen sind in der Vordergrund gerückt.
Außerdem bekam die Bewegung vor einem Jahr vor allem auch einen großen Zuwachs an jungen weißen Menschen. Diese werden aber mittlerweile nicht mehr täglich mit der Thematik Rassismus konfrontiert, da sie ihn nicht Tag für Tag erleben müssen. Und da die große Medienwelle zu diesem Thema vorbei oder zumindest kleiner geworden ist, hat sich bei vielen Menschen der Fokus verschoben. Zu dem kommt, dass die Bewegung durch konservative, rassistische Propaganda teilweise in ein schlechtes Licht gerückt wurde.
Klar ist auf jeden Fall, dass der Tod von George Floyd ein Moment war, der viele Steine ins Rollen gebracht hat. Und das weltweit. Klar ist aber auch, dass das Problem Rassismus heute immer noch so aktuell wie vor einem Jahr ist.
Digitalisierung des Gesundheitssystems – Solidarität für alle?
In der deutschen Gesellschaft vollzieht sich ein Wandel. Der Altenquotient steigt, heute ist jede zweite Person älter als 45 Jahre und jede fünfte Person älter als 66 Jahre. Das belastet den Generationenvertrag, da mehr Menschen Leistungen wie die Altersrente beanspruchen, während weniger Menschen mit ihren Beiträgen die Töpfe füllen.
Auch die digitale Revolution wird immer mehr zu einem unumgänglichen Thema. Es droht der massenhafte Verlust menschlicher Arbeitsplätze, da viele Tätigkeiten in Zukunft wohl von effizienteren Computerprogrammen und Robotern ersetzt werden.

Digitaler Arztbesuch? Das Smartphone macht’s möglich.
National Cancer Institute on Unsplash
Chance Digitale Revolution
Doch der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) und digitaler Technologien birgt auch ungemeine Chancen. Grade im Sektor der gesundheitlichen Versorgung werden Algorithmen und digitale Sprechstunden mit Ärzt*innen in den nächsten Jahren wohl unabdingbar. Einer der großen Player wird hier wohl (wie so oft) der Onlineversandriese Amazon. Im Projekt 1492 erforschen Entwickler*innen, wie sie mithilfe von medizinischen Aufnahmegeräten und Health-Tracking-Apps an die Gesundheitsdaten der Kund*innen kommen. Die erhobenen Daten sollen dann in einer Art Cloud für medizinisches Personal zugänglich gemacht und archiviert werden. Die Daten der Kund*innen würden darüber hinaus analytisch ausgewertet. Anhand der Datenanalyse könnte der Konzern dann mögliche Erkrankungen vorhersagen und prophylaktisch passende Therapien vorschlagen, bevor die Krankheit je ausbricht. Amazon verspricht sich davon wohl einen zusätzlichen Gewinn über die Vermittlung kostenpflichtiger Arzttermine. Außerdem scheint die Firma am Aufbau eines eigenen Telemedizin-Netzes interessiert zu sein. Kund*innen könnten dann bequem von zuhause eine Sprechstunde bei einer spezialisierten Person ihrer Wahl wahrnehmen.
Unabhängig von Amazon entstehen auch Unternehmen, die zu medizinischen Chips forschen. Diese unter der Haut befindlichen, millimetergroßen Datenträger könnten als eine Art Krankenkassenkarte funktionieren. Der oder die Chiptragende kann auf ihm Informationen zu Vorerkrankungen, Allergien und vorhandenen Impfungen etc. speichern. Medizinisches Personal könnte diese dann im Notfall innerhalb weniger Sekunden abrufen, ohne dass der*die Patient*in dafür bei Bewusstsein sein muss.
Effizient, Einfach und Barrierefrei?
Zuerst einmal erhöht die Digitalisierung die Effizienz des Gesundheitssystem immens. Durch die Verwendung von KI können Fälle verglichen und besser diagnostiziert und behandelt werden. Die Quote der Fehldiagnosen ist bei KI deutlich geringer. Durch die oben erklärten Chips werden Pflegekräfte rechtzeitig über Vorerkrankungen, Allergien und weitere Umstände aufgeklärt. Das minimiert den Zeitaufwand und kann im Zweifel Leben retten. Kund*innen eines Telemedizin-Anbieters können virtuell Spezialist*innen aufsuchen, was die Ansteckungsgefahr im Wartezimmer und den Aufwand verringert. Grade in Zeiten der Pandemie können digitale Sprechstunden bei minderen Beschwerden das chronisch unterbesetzte Gesundheitswesen entlasten. Auch im Kampf gegen den Ärztemangel in ländlichen Regionen können digitale Angebote hilfreich sein. Zu beachten ist jedoch, dass nicht alle Menschen Zugang zu einer ausreichend schnellen und zuverlässigen Internetverbindung haben, um sich auch in der gesundheitlichen Versorgung vorwiegend auf sie zu verlassen. Diesen Menschen bringen digitale Sprechstunden rein gar nichts, egal wie zeit- und kostensparend sie auch sein mögen.
Armut ist ein Gesundheitsrisiko
Digitale Technologien im Gesundheitswesen retten Leben, können Hindernisse senken und die Alltagsbelastung grade für medizinische Angestellte und auch Patient*innen senken. Es ist jedoch essenziell zu beachten, dass nicht alle Menschen den gleichen Zugang zu den neuen Verbesserungen haben werden. Grade im Bonus-Malus-System, also in Programmen, die gesundheitlich förderndes Verhalten mit Boni belohnen und schädliches Verhalten direkt oder indirekt bestrafen, beispielsweise durch höhere Beiträge, können viele nicht profitieren, weil ihre Umstände es nicht erlauben. Der Fokus liegt hier auf dem Verhalten der Einzelperson, gesundheitsschädliche Umstände wie Armut und unvermeidlicher Stress werden missachtet und benachteiligte Personen werden zusätzlich geringere Boni und somit höhere Beiträge gemaßregelt. Auf lange Sicht ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich eine soziale Spaltung zwischen Wohlhabenden, die sich ein gesundes Leben leisten können und Ärmeren, die das eben nicht können, herausbildet. Es entsteht ein potenzielles Spannungsfeld. Der Fokus auf die einzelne Person wirkt auch der gesellschaftlichen Solidarität entgegen, da der Anschein erweckt wird, jede*r sei für seine*ihre Gesundheit alleine verantwortlich, was so einfach nicht stimmt. Durch den Aufstieg des Gesundheitswesens zu eines Art Erziehungsunternehmen wird den Bürger*innen zusehends durch psychologische Impulse (Nudges) vorgeschrieben, wie sie ihr Leben führen sollen. Dies geschieht natürlich nicht explizit, findet aber statt, sobald gesundheitsschädliches Verhalten in finanziellen Nachteilen (höheren Beiträgen) resultiert. Bedenklich ist für mich auch, das privatwirtschaftlichen Unternehmen wie Amazon eine solche Macht überlassen wird. Die Erhebung abertausender Patient*innendaten, macht uns für Amazon transparent und manipulierbar, da sie wissen, was uns bewegt und wie es uns geht. Es muss klar bleiben, dass Konzerne immer eher an der Steigerung ihres Gewinns als am Wohl ihrer Kund*innen interessiert sein werden. Meiner Meinung nach ist es ein erhebliches Sicherheitsrisiko Amazon die Daten ohne staatliches Mitspracherecht zu überlassen. Generell bin ich nicht der Meinung, dass ein profitorientiertes Gesundheitssystem eine gute Idee ist. Die verheerenden Folgen für die gesundheitliche Absicherung zeigt sich wohl am privaten Gesundheitssektor der USA, wo fehlende Versicherung und horrende Arztrechnungen zum Alltag Vieler gehören.
Mit Blick auf die Leitfrage lässt sich sagen, dass die digitale Neuerung im Gesundheitswesen nicht das Solidaritätsprinzip als Fokus zu haben scheint. Verhaltensbasierte Versicherungen und das Prämienmodell hebeln die bisherige Solidarität der Stärkeren mit den Schwächeren aus und erschaffen stattdessen ein Gerechtigkeitsverständnis nach dem Äquivalenzprinzip, das den Schwächeren schadet, während es den Stärkeren zugutekommt, da sie nicht mehr für die Schwächeren aufkommen müssen. Auch 1492 bringt eine Reihe finanzieller und strukturellen Hürden mit sich, die alles andere als solidarisch sind. Um von Amazons Programmen profitieren zu können, muss man Geld und digitale Kompetenzen, sowie Zugang zu einer verlässlichen Internetverbindung haben.

Auch das Gesundheitswesen muss digitalisiert werden.
Markus Spiske on Unsplash
Und wie geht’s weiter?
Meiner Ansicht nach bringt ein digitalisiertes Gesundheitswesen immense Vorteile mit sich. Es ist jedoch immens wichtig, dass alle Menschen, unabhängig ihrer ökonomischen und sozialen Lage, gleichermaßen von den Neuerungen profitieren können. Dafür braucht es, denke ich, eine Beteiligung des Staats an Angeboten wie 1492. Generell müssen Bund und Länder digital dynamischer und besser aufgestellt werden, um den nahenden digitalen Umbruch zu meistern und nicht von der schieren Übermacht von Tech-Giganten wie Amazon überrumpelt zu werden. Außerdem brauch es Konzepte, wie Menschen, die sich den digitalen Neuerungen nicht beugen können oder wollen einen Nachteilsausgleich erhalten. Auch älter und ärmere Mitbürger*innen verdienen eine moderne und effiziente gesundheitliche Versorgung. Es braucht, meiner Meinung nach, weiterhin Solidarität als Grundbaustein unserer Krankenversicherungen. Um diese zu erwirken, sollte man mehr über die Gefahren der vermutlich aus dem anti-solidarischen System resultierenden sozialen Ungleichheit sprechen. Studien beweisen, dass auch die Privilegierten unter einer zu großen Spaltung in der Gesellschaft leiden, sie werden geplagt von Stress und Burnout, Depressionen und Statusangst. Schlussendlich gilt es, die Frage nach Solidarität im Gesundheitssystem nicht technologisch zu verengen. Auch die Förderung von Migrant*innen und BIPOC als medizinisches Fachpersonal baut Hürden für strukturell benachteiligte Gruppen ab.
Damit der Altenquotient (das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentenempfangenden) nicht überproportional steigt, sind eine Steigerung der Fertilitätsrate mittels gezielten Anreizen (z.B. höheres Kindergeld, verlässliche Kita-Angebote, gesicherte & längere Elternzeit für beide Eltern) eine Idee. Auch von gezielter Migration junger Erwerbstätiger ist immer wieder die Rede. Sie ist eine Chance, den Generationenvertrag in Teilen zu entlasten, kann die Entwicklung aber nicht realistisch aufhalten, da dafür innerhalb der nächsten Jahr mehrere Millionen Menschen einwandern und sozialabgabenpflichtig eingestellt werden müssten.
Ein Weg aus dem Dilemma der steigenden Zahl Bedürftiger und der sinkenden Zahl Zahlender sind steigende Beiträge oder Kürzungen der Leistungen beziehungsweise eine teilweise Privatisierung, bei der bestimmte Leistungen, z.B. Zähne und Psychotherapie nur noch gegen Zuzahlung von der Versicherung gedeckt sind ein Lösungsansatz.
Wenn man Gesundheit für Alle haben möchte, sollte man auch darüber nachdenken, dass Renteneintrittsalter nach hinten zu verschieben, damit die Menschen länger ins umlagefinanzierte System einzahlen. Um Arbeit im Alter zu ermöglichen, sollten Konzerne über eine betriebliche Altersversorgung, flexible Arbeitszeitmodelle und geregelte Altersteilzeit nachdenken. Es braucht altersgerechte, ergonomische Arbeitsplätze, an denen sich auch der digitalen Technologien bedient wird. Unternehmen sollten den älteren Arbeitnehmer*innen mehr Homeoffice sowie einen flexiblen Übergang in die Ruhephase bieten. Auch Mentorenprogramme, in den ältere und jüngere Arbeitnehmer*innen in einer Art Buddy-System voneinander lernen, sollten in Betracht gezogen werden, um die Expertise der Älteren zu nutzen.
Darüber hinaus kann man auch darüber nachdenken die Private Krankenversicherung aufzulösen, damit alle Menschen in den Solidartopf einzahlen. Momentan ist es oft so, das Wohlverdienende nach einiger Zeit von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung wechseln, da hier die Einstiegsbeiträge im Zweifel geringer und die Leistung besser ist. Das kostet die gesetzliche Krankenkasse stark benötigtes Geld.
Durch Boni geförderte Programme, die zu gesundheitsbewussteren Verhaltensweisen “erziehen” sind eine weitere Methode, die Kosten der medizinischen Versorgung zu senken. Allerdings muss auch dieses Programm zwingend Solidaritätsprinzipien beinhalten und darf niemanden benachteiligen.
#NotAllMen und der Zorn der belästigten Frauen
Trigger-Warnung: sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Mord
Ich bin wütend. Neulich bin ich abends nach Hause gefahren. Ich sitze also in der Tram und scrolle durch Instagram. Mir gegenüber sitz ein Typ, Anfang oder Mitte dreißig, die Beine breit, die Maske lässig unter der Nase hängend. Ich schenke ihm keine große Beachtung, habe ihn nur kurz wahrgenommen, als er einstieg und sich mir gegenüber niederließ.
Irgendwann stups er mich mit seinem Fuß an. Ich blicke auf. Er nickt mir zu und sagt „Na Süße? Kriegt man deine Nummer?“. Ich verneine und gucke dabei wahrscheinlich etwas irritiert, immerhin ist er wahrscheinlich 20 Jahre älter als ich. Er entgegnend jedenfalls, ich solle nicht gleich so sauer gucken, er hätte ja nur nett sein wollen. Er lehnt sich nach vorne und stützt sich auf seinen Knien ab. Mir ist das zu nahe, ich stehe auf und gehe zur übernächsten Tür. Er ruft mir noch etwas hinterher, ich ignoriere ihn und steige aus. Es ist nicht meine Haltestelle, aber ich sitze lieber ein paar Minuten in der Kälte, als weiter mit ihm in einer Bahn zu sein. Nachdem sicher ist, dass er mir nicht aus der Bahn gefolgt ist, entspanne ich mich ein wenig.
Der Rest der Fahrt ist ereignislos. Über Kopfhörer höre ich Musik. Es ist mittlerweile kurz vor 10 Uhr. Die Tram hält, ich steige aus. Die Ampel ist rot, ich bleibe also stehen. Von der Seite nähert sich mir ein Mann. Ich merke ihn erst nicht, er tippt mich an. „Hauptbahnhof?“, fragt er mich. Er spricht undeutlich, scheint betrunken zu sein. Ich reagiere nicht sofort und er fragt nochmal. Ich deute in die Richtung, wo die Bahn in Richtung Hauptbahnhof fährt. „Da lang.“, sage ich ihm. Er lächelt mich an, lehnt sich nach vorne – und stolpert gegen mich. Nicht sonderlich heftig, aber so, dass sich sein Körper für einige Sekunden in kompletter Länge gegen meinen presst. Ich schiebe ihn mit meinem Arm von mir weg. Mir ist ein bisschen schlecht.
Nachdem ich die Straße überquert habe, rufe ich eine Freundin an. Ich sage ihr, wo ich bin und das da ein Mann ist, der mir Angst macht. Mit schnellen Schritten laufe ich nach Hause und wende mich noch ein paar Mal um, um zu sehen, dass er mir nicht folgt. Tut er nicht, trotzdem habe ich in meiner Jackentasche meine Hand so um mein Schlüsselbund geballt, das zwischen jedem meiner Knöchel ein spitzer Schlüssel hervorragt. Das Handy in der linken, die improvisierte Waffe in der rechten Hand, komme ich zu Hause an. „Puh“, denke ich. „Vielleicht doch etwas überreagiert.“, sage ich meiner Freundin.
Nach ein bisschen Nachdenken finde ich nicht, ich hätte überreagiert. Innerhalb von 20 Minuten haben zwei verschiedene Männer mich, eine 17-Jährige, auf eine Weise angesprochen, die mir das Gefühl gab, ihnen ausgeliefert zu sein. Beide Male war ich in einer gut ausgeleuchteten Umgebung, beide Male befand ich mich in Hörweite anderer Menschen. Beide Male muss offensichtlich gewesen sein, dass ich Angst hatte, beide Male hat sich niemand eingemischt.
Diese Begegnungen sind nichts neues. Als Frau wird einem regelmäßig hinterher gepfiffen oder gerufen, man wird angestarrt, angemacht und beschimpft, grade wenn man seinen Unwillen äußert. Wissen wir alle, passiert ständig. Ist auch für mich nicht das erste Mal. In der U-Bahn hat mir mal einer richtig heftig an den Hintern gefasst. In einem vollen Wagon, umgeben von Beobachtenden. Da war ich grade 15 geworden. Ich glaube, ich hab in meinem Leben noch nie so geheult. Dreckig und ohnmächtig habe ich mich gefühlt.
Jede meiner Freundinnen kann Ähnliches, oft viel Schlimmeres berichten. Oft telefonieren wir, wenn wir vorher zusammen unterwegs waren, damit niemand verloren geht. Zwei von ihnen tragen immer Pfefferspray oder andere Waffen zur Selbstverteidigung an sich. Wenn ich unterwegs bin, grade wenn ich vor habe zu trinken, trage ich immer meine Doc Martens-Stiefel, um im Notfall rennen oder treten zu können. In der Bahn achte ich darauf, nicht zu viel Haut zu zeigen. Ich sitze aufrecht und achte darauf, meine Schultern breit zu halten, damit ich nicht als leichtes Opfer ins Visier übergriffiger Männer gerate.
All das gehört zu meinem Alltag. In meinem Hinterkopf schwebt immer der Gedanke an die Gefahr, die von den Männern in meiner Nähe ausgeht. Und ich bin weiß, körperlich nicht grade klein und trage kein Kopftuch. Ich will mir nicht vorstellen, wie angsteinflößend der Nachhauseweg für andere Frauen sein mag.
Das ist doch scheiße, oder? Das ich mich nicht sicher fühle, wenn ich allein bin. Und eben auch, dass ich mein Verhalten anpasse. Es gibt Klamotten, die ich nicht trage und Ort die ich nicht betrete, wenn es dunkel ist und ich allein unterwegs bin. Ich passe mich an, schränke mich ein, obwohl ich doch ganz eindeutig nicht das Problem bin. Vielen Frauen geht es genauso.
Das zeigt auch die Debatte um die Sicherheit von Frauen im öffentlichen Raum, welche nach dem Verschwinden der 33-Jährigen Sarah Everard auf ihrem Nachhauseweg durch London entbrannte. Everard verschwand am Abend des 3. März. Sie trug helle Klamotten, Laufschuhe, war nicht betrunken, ging schon gegen halb zehn, wählte einen gut ausgeleuchteten Weg und kontaktierte ihren Freund, damit er wusste, wo sie war. Sarah tat alles, was jungen Frauen und Mädchen ein Leben lang eingetrichtert wurde, um sicher zu bleiben. Und trotzdem passierte ihr das Unaussprechliche. Mittlerweile sitzt ein Polizist wegen der Entführung und Ermordung Everards in Untersuchungshaft.
In Folge des Verbrechens an Sarah Everard entbrannte in Großbritannien und weltweit eine Debatte, in der Menschen, insbesondere Frauen, unter Hashtag wie #reclaimthestreets ihre Erfahrungen teilen und für Gesetze und Maßnahmen plädieren, die die Gefahr für Frauen im Alltag minimieren. Scheint einleuchtend, nicht wahr? Eine Frau, wird auf dem Nachhauseweg ermordet und Tausende Frauen sagen: „Es reicht! So geht das nicht weiter!“. Doch innerhalb von Stunden werden überall im Internet und in der Öffentlichkeit generell Rufe wie „Not all men“ (‚Nicht alle Männer‘) laut. Diese Menschen reden davon, dass nicht alle Männer Vergewaltiger, Mörder, Frauenhasser sind und versuchen damit den Aufschrei zu diskreditieren. Nicht wenige Männer machen den (leider ernstgemeinten) Vorschlag, Frauen sollen einfach nicht mehr so spät das Haus verlassen, wenn sie sich nicht sicher fühlen. Außerdem sein diese Frauen ja auch total hysterisch und würden komplett überreagieren. In einer Welt voller Feminist*innen und #Metoo könne die Lage doch gar nicht mehr so schlimm sein. Es handle sich nur um den nächste Schritt der männerhassenden Verschwörung, die den Männern ihre Positionen wegnehmen wolle, um sie dann an die BH-losen, unrasierten, radikalen Feministinnen dieser Welt zu geben.
Aber darum geht es nicht. Es ist grundlegend falsch, Frauen einzuschärfen, es wäre ihre Schuld, wenn Männer sie bedrängen, belästigen, begrapschen. Klassisches sogenanntes „victim-blaming“, als die Schuldzusprechung des Opfers. Wenn Männer Frauen vergewaltigen, oder sie sexuell belästigen, dann tun sie das nicht, weil die Frau einen zu kurzen Rock oder ein zu freizügiges Oberteil tragen. Sie tun es, weil sie sich mächtig fühlen. Weil sie wissen, dass die Schuld immer noch in zu vielen Fällen beim Opfer gesucht wird, weil sie wissen, dass es selten zur Verurteilung kommt und dass Vergewaltigungen selten zur Anzeige und Strafverfolgung gebracht werden.
In der Debatte geht es nicht darum, Männer generell zu verurteilen oder ihre Rechte einzuschränken. Es geht um ein Klima, das es Frauen nicht erlaubt, sich frei und selbstbestimmt zu bewegen. Eine Gesellschaft, die Männern immer noch „sexuelle Fehltritte“ erlaubt und zu vielen von ihnen das Gefühl gibt, sich nehmen zu können was sie wollen. Es geht um die Aufarbeitung einer Vergewaltigungskultur, in der jede Frau einen Berg voll Erfahrungen mit übergriffigen Männern hat. Es geht darum, endlich ein zielführendes Gespräch darüber zu führen, dass 2018 an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem jetzigen oder früheren Partner umgebracht wurde. Das ist keine „Hexenjagd“ gegen alle Männer. Nein, der Feminismus ist nicht „endgültig zu weit gegangen“. Wir verlangen nichts Abwegiges. Wir wollen uns sicher fühlen. Wir wollen keine Angst mehr, vor jedem Mann haben müssen, der uns nachts auf der Straße begegnet. Wir wollen ein Minimum an menschlicher Würde, und trotzdem ist es für viele Menschen (grade Männer) immer noch nicht selbstverständlich, Frauen zuzuhören, wenn sie über ihre Erfahrungen sprechen und die das Gefühl haben, sich und ihr Geschlecht, mit Aussagen über die Klamotten des Opfers oder den „stärkeren Sexualtrieb der Männer“ verteidigen zu müssen. Nicht alle Männer, aber solche Männer sind das Problem.
Das Bedingungslose Grundeinkommen – Zukunft des deutschen Sozialstaats?
Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein Konzept, bei dem jeder Mensch monatlich einen bestimmte Menge Geld ausgezahlt bekommen würde, ohne etwas dafür tun zu müssen. Geschenktes Geld also – klingt erstmal toll, oder? Doch wie funktioniert es? Woher kommt das Geld? Und welche Folgen hätten solche Zahlungen?
Die Idee
Jede*r Bürger*in erhält – unabhängig von ihrer oder seiner Lage – eine gesetzlich festgelegte und für jede*n gleiche, vom Staat ausgezahlte finanzielle Zuwendung, ohne dafür eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Diese Finanzleistung wäre ohne weitere Einkommen oder bedingte Sozialhilfe existenzsichernd, würde also ein Leben ohne Armut ermöglichen. Für die Verwendung des Geldes gäbe es keine Überprüfungen und keine Bedingungen, jeder darf damit machen, was er/sie möchte. Neben dem Schutz vor Armut wäre ein BGE in seiner Essenz auch ein Ersatz für die momentan existierenden, abgabenfinanzierte Sozialleistungen wie das Arbeitslosengeld, die Sozialhilfe und das Kindergeld.
In Deutschland wird je nach Modell eine Zahlung in Höhe des Arbeitslosengeldes II (Hartz 4) bis zu einer Zahlung von 1500 € im Monat vorgeschlagen. Zusätzliches Einkommen ist immer erlaubt und wird, anders als im jetzigen System, nicht auf das bedingungslose Grundeinkommen angerechnet. Das heißt, das BGE kann nicht gekürzt werden, wenn Empfänger*innen hinzuverdienen.
In der Umsetzung wäre eine starke Vereinfachung und Neuordnung des Steuersystems und weniger Aufwand in der Sozialverwaltung vorgesehen, da die bisherigen Sozialleistungen nach und nach durch das Grundeinkommen ersetzt würden.

Das BGE erfordert eine Neuordnung des Steuersystems Foto: Lena Balk via Unsplash
Und wer soll das zahlen?
Für 2016 betrugen die Sozialleistungen in Deutschland laut statistischem Bundesamt insgesamt 918 Mrd. Euro. Ein BGE würde den Staat je nach Höhe im Jahr zwischen etwa 600 und 1.100 Mrd. Euro kosten. Durch den Wegfall anderer Sozialleistungen würden Mittel in Milliardenhöhe frei, es ist jedoch offensichtlich, dass diese Mittel nicht ausreichen werden, das BGE zu finanzieren. Das fehlende Geld könnte der Staat durch erhöhte Steuern in bestimmten Bereichen erwirtschaften. Hier ist die Rede von der Besteuerung von Konsum, der Besteuerung des Einkommens, der Besteuerung natürlicher Ressourcen und/oder der Besteuerung des Geldverkehrs. Die bezweckte Wirkung aller Finanzierungsmodelle ist die Umverteilung des Vermögens von Reich zu Arm. Reiche machen also geringe Einbußen, während Arme hinzugewinnen.
Pro und Kontra
Aber hätte ein BGE wirklich das Ende von Armut zur Folge? Oder würde die komplette Umstrukturierung des Sozialstaats mehr Schaden anrichten, als es Nutzen bringen würde?
Erst einmal kostet ein Universelles Grundeinkommen mehr als momentan für den deutschen Sozialstaat zur Verfügung steht, folglich wären Steuererhöhung wäre nötig, das könnte die Kaufkraft der Bevölkerung beschränken und der Wirtschaft schaden. Außerdem können Arbeitgebende das BGE missbrauchen, um die Löhne so niedrig wie möglich zu halten und die Last fairer Löhne auf die öffentliche Hand abzuwälzen. Gewerkschaften warnen, ein BGE sei gleichbedeutend mit Lohnsubventionen – es käme also vor allem Unternehmen zugute.
Christoph Butterwegge, deutscher Politikwissenschaftler, befürchtet, das BGE könnte den Druck Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen senken, da Arbeit keine Notwendigkeit zu einem komfortablen Leben mehr wäre.
Fakt ist aber, dass die aktuell praktizierte „Arbeitslosenindustrie“ in vielerlei Hinsicht nicht ideal funktioniert. Einige Programme zur Wiedereingliederung Beschäftigungsloser verlängern sogar die Arbeitslosigkeit, während die Kosten für Sozialarbeiter*innen, die Arbeitssuchenden helfen sollen, nicht selten den Gewinn für Arbeitslose an Wert übersteigt. Könnte hier ein bedingungsloses Grundeinkommen, das direkt und ohne Auflagen gezahlt wird die bessere Option sein?
2009 startet in London ein einmaliger Versuch. Die Versuchsteilnehmer*innen sind 13 Obdachlose, die den Staat bisher geschätzte 400.000 Pfund im Jahr für Polizeieinsätze, Gerichtskosten und Sozialdienste kosteten. Von jetzt an erhalten sie je 3.000 Pfund monatlich ohne Auflagen zur Verwendung, ohne Überprüfungen, ohne eine Gegenleistung erbringen zu müssen. Ein Jahr nach Studienbeginn hat der Durchschnitt nur 800 Pfund ausgegeben; nach anderthalb Jahren haben 7 der Obdachlosen wieder ein Dach über dem Kopf und mehrere haben eine Aus- oder Weiterbildung angefangen. Geschenktes Geld halt also einen Effekt. Bedürftige Menschen erhalten die Mittel, in ihre Zukunft zu investieren.

Bedrohung für menschliche Arbeitsplätze: Roboter
Foto: Alex Knight via Unsplash
Sicherheit im Wandel
Immer klarer zeichnet sich ab, dass der technologische Fortschritt mit hoher Wahrscheinlichkeit den Wegfall hunderttausender menschlicher Arbeitsstellen zur Folge haben wird. Ein BGE hätte die Macht die Schockwellen der digitalen Revolution abzufangen und in einer Welt, die einem atemberaubend rasanten Wandel unterworfen ist, für Sicherheit und Stabilität zu sorgen.
Götz Werner, Anthroposoph und Gründer der dm-Drogeriekette sagt über das bedingungslose Grundeinkommen es würde nach den Gesetzen des freien Marktes (Angebot und Nachfrage) dazu führen, dass bisher schlecht bezahlte, aber notwendige Arbeit besser bezahlt und attraktiver gestaltet werden würden. Er rechnet damit, dass der wegfallende Arbeitszwang Menschen im Kampf um faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen stärken würde, da sie nicht länger auf die Stelle angewiesen wären.
Monströser Sozialstaat
Der Sozialstaat, der eigentlich Sicherheit und Selbstwert vermitteln sollte, ist in den vergangenen Jahren immer weiter zu einem System von Misstrauen und Scham degeneriert: Menschen, die auf Leistungen wie Arbeitslosengeld II angewiesen sind, werden systematisch kontrolliert und erniedrigt. Beamte überwachen die Finanzen und den Besitz potenzieller Unterstützungsempfänger*innen, um zu kontrollieren, ob die Leute ihr Geld vernünftig ausgeben und wirklich bedürftig sind. Gelingt ihnen dieser Nachweis nicht, werden ihnen die Leistungen gekürzt; Formulare, Interviews, Kontrollen, Einsprüche, Bewertungen, Konsultationen und noch mehr Formulare: für jeden Antrag auf Unterstützung gibt es ein Verfahren, dass entwürdigt und Misstrauen sät. Mit der Einführung eines BGEs würde der Zwang zur Arbeit entfallen. Die Stigmatisierung Erwerbsloser würde voraussichtlich ausbleiben, da alle von den gezahlten Leistungen profitieren würde und somit der Vorwurf des Schmarotzertums schlichtweg nichtig würde.

Nie wissen, ob das Geld reicht, macht krank. Foto: Sharon McCutheon via Unsplash
Folgen von Armut
Armut hat ernstzunehmende gesundheitliche Auswirkungen: Arme Menschen haben deutlich geringere Lebenserwartungen. Personen, die sich auf ein BGE verlassen, können Arbeit unter gesundheitsschädlichen Bedingungen leichter ablehnen oder die Verhältnisse verbessern. Wer Einfluss auf die eigenen Lebensbedingungen hat und sich nicht unterordnen muss, lebt gesünder. Ausschlaggebend für das Wohlergehen der Bürger*innen eines Landes ist immer das Maß an Ungleichheit zwischen ihnen. Arme Menschen in reichen Ländern sehen tagtäglich, dass es anderen Menschen finanziell besser geht, und bekommen oft zu spüren, dass sie nicht dazu gehören. Armut in reichen Ländern hat psychologische Konsequenzen. Sie beeinträchtigt die Qualität der Beziehungen und führt beispielsweise zu Misstrauen gegenüber Fremden sowie zu Statusangst. Der daraus resultierende Stress trägt erheblich zu Krankheiten und chronischen Gesundheitsproblemen bei.
Wohlstand gleich verteilen
Ein BGE das z.B. über die Einkommenssteuer finanziert wird, würde Reichtum neu und gleichmäßiger verteilen und hätte die Macht, die sich in rasantem Tempo öffnende Schere zwischen Arm und Reich einzufrieren oder sogar zu schließen.
Geschenktes Geld funktioniert
Studien aus aller Welt belegen: Geschenktes Geld funktioniert. Es liegen bereits Forschungsergebnisse vor, die zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen auflagefreien Zuschüssen und einer Verringerung von Kriminalität, Kindersterblichkeit, Mangelernährung, Teenagerschwangerschaften und Schulabwesenheit sowie einer Steigerung der schulischen Leistungen, des Wirtschaftswachstums und der Gleichberechtigung der Geschlechter gibt.
Tod der Arbeitskultur

Burnouts gehören heute zum Arbeitsalltag
Foto: Alex Kotliarskyi via Unsplash
Eine große Befürchtung ist, das BGE würde den Tod der Arbeitskultur herbeiführen, da niemand mehr arbeiten wollen würden, wenn fürs Einkommen gesorgt wäre. Für einige Arbeitnehmer*innen mag das tatsächlich der Fall sein.
Seit Jahrzehnten zeigt sich eine durchweg steigende Belastung durch Arbeit, Überstunden, Kinderbetreuung und Bildung: 1985 nahmen diese Aktivitäten 43,6 Stunden pro Woche in Anspruch, bis 2005 stieg die Belastung auf 48,6 Stunden. Nicht selten hört man Menschen prahlen, sie seien regelmäßig 60 oder 70 Stunden in der Woche bei der Arbeit; Depression und Burnout gehören zum Arbeitsalltag und sind keine Einzelfälle mehr, außerdem wird es immer schwieriger, Arbeit und Freizeit voneinander zu trennen. Durch das BGE entfällt der Zwang und Menschen würde der Freiraum gegeben, zu hinterfragen, ob sie überhaupt arbeiten wollen und wenn ja, wie diese Arbeit aussehen soll.
Zweifellos würden sich einige Bürger*innen entscheiden, weniger zu arbeiten, aber das ist ja ein Zweck des BGE, und es gibt zahlreiche Belege dafür, dass die meisten Menschen tatsächlich arbeiten wollen, unabhängig davon, ob sie darauf angewiesen sind oder nicht. Denn die Motivation zur Arbeit ist eben nicht nur monetärer Art, sondern entsteht auch durch Anerkennung, Selbstverwirklichung und soziale Integration.
Weiter ermächtigt das BGE selbst zu entscheiden, welche Arbeit zumutbar ist. Das wäre eine neue Arbeitsmoral, die individuelle Freiheit und Verantwortung statt erzwungener Tätigkeit großschreibt.
Weniger zu arbeiten, gibt den Menschen die Möglichkeit, mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, sich ehrenamtlich für ihre Gemeinschaft zu engagieren und sich politisch stark zu machen, Viele Bürger*innen hätten zum ersten Mal die Möglichkeit, sich intensiver mit politischen und sozialen Themen auseinanderzusetzen, aktiv zu werden und somit an einer lebendigeren Demokratie zu partizipieren.
Meiner Meinung nach bringt das BGE viel Positives mit sich. Es wäre ein würdevoller Weg, Menschen aus der Armut zu befreien, würde in Krisenzeiten die Menschen vor Not durch Verdienstausfälle bewahren und könnte so auch zur Bewältigung der Coronapandemie hilfreich sein. Doch noch ist nicht alles geklärt. Es bedarf weiterer Studien und Experimente zu Langzeitfolgen und Effekten für die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft.
Ich denke das universelle BGE ist eine vielversprechende Perspektive für das marode soziale Netz der Bundesrepublik:
Wenn das BGE mit der nötigen Übergangszeit und einem effektiven, nachhaltigen Finanzierungsmodell eingeführt wird, kann es, meiner Meinung nach, ein sehr effektives Mittel gegen Armut und die Stigmatisierung Erwerbsloser sein.
In Zeiten großer Unsicherheiten aufgrund der Covid-19-Pandemie erhielt die Diskussion um das BGE wieder neuen Aufschwung: Im Januar 2021 startete ein Forschungsprojekt des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Hier soll Grundlagenforschung geliefert werden: Im ersten Schritt werden die individuellen Effekte von 1.200 € zusätzlich pro Monat erforscht, um Indizien für die Wirkung auf die gesamte Gesellschaft zu sammeln. Die Effekte werden mit einer Vergleichsgruppe überprüft. Die Studie rekrutierte 1.500 Proband*innen, von denen 120 zufällig Ausgewählte das Geld erhalten, während der Rest als Vergleichsgruppe dient. In zwei weiteren Studien werden anschließend Grundlagen der Finanzierbarkeit getestet.
Der Tod der Mittelschicht
Die Mittelschicht, das ist der Kern unserer Gesellschaft. Seit Jahrhunderten bildet sie die Mehrheit der Bevölkerung. Sie hält den Staat am Laufen und ist ausschlaggebend in der Arbeitswelt. In der Ökonomie und Politik wird die Mittelschicht als tragende und stabilisierende Kraft in der Gesellschaft angesehen. Um diese Funktion ausreichend erfüllen zu können, muss der Mittelstand einen möglichst großen Anteil der Bevölkerung ausmachen.

Geld regiert die Welt – schon immer
Im wirtschaftlichen Sinne teilt sich die Gesellschaft entlang dem Mittelwert der Gehälter in die einkommensstärkere und die einkommensschwächere Hälfte. Der Mittelstand wird definiert als alle Erwachsenen die als Alleinstehende vor Steuern und Sozialabgaben zwischen 60 und 200 % des Mittelwerts verdienen. Das sind aktuell monatlich zwischen 1500 und 2800 € netto im Monat.
Bis zum Ende des deutschen Kaiserreichs waren die Menschen klar in die Klassen des Adels bis zu den Besitzlosen geteilt. Diese wurden danach mit der voranschreitenden Demokratisierung in der Weimarer Republik durch gesellschaftliche Schichten abgelöst. Stark vereinfacht waren das die Ober-, Mittel- und Unterschicht.
Der Mittelstand schrumpft
Seit den 1990er Jahren schrumpft die Mittelschicht kontinuierlich. 2013 hatte die Mittelschicht einen Anteil von 54 % an der Bevölkerung in Deutschland. Das sind im Vergleich zu 1991 ganze 6 Prozentpunkte weniger. Es zeigt sich: die Mitte schrumpft. Als zentralen Auslöser dieser Entwicklung sehen Expert*innen das Anwachsen des Niedriglohnsektors in Deutschland, welcher durch eine Zunahme geringbezahlter Jobs in der Dienstleistung und dem Wegfall industrieller Arbeitsplätze begünstigt wird. Auch werden immer mehr Vollzeitstellen in Stellen für Leih- und Zeitarbeit, ebenso wie geringfügige und befristete Beschäftigungen umgewandelt, da diese für die Arbeitgebenden billiger sind.
Dieser Prozesse wird ausgelöst durch das Voranschreiten der Globalisierung und hat schlussendlich eine Verstärkung der Einkommensschere, also der Trennung von Arm und Reich und wachsende soziale Ungleichheit zur Folge. Besonders betroffen in Deutschland sind Menschen mit Migrationshintergrund. Der Mittelstand schrumpft, ebenso ihr Anteil am Volksvermögen. Sie wird zu dem – wie die gesamte deutsche Gesellschaft – älter.
Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer
Gleichzeitig explodieren die Mieten, grade in den momentan so lebenswerten Großstädten. Die Lebenskosten steigen rasant. Darüber hinaus zahlen Deutsche im Vergleich zu europäischen Mitbürger*innen sehr hohe Steuern und Sozialabgaben. Die Kaufkraft und die Fähigkeit des Mittelstands, Vermögen anzusammeln sinkt.
Nichtsdestotrotz verdienen die Vorstände der Top 30 Unternehmen in Deutschland heute zehnmal so viel wie noch vor 30 Jahren. An den Angestellten ist dieser wundersame Geldzuwachs aber spurlos vorbei gegangen, das Realeinkommen ist nur moderat gestiegen. Die Durchschnittslöhne halten nicht Schritt mit der generellen Vermögensentwicklung. Trotz jahrelangem Konjunkturhoch und Rekordbeschäftigung fürchten immer mehr Bürger*innen um ihre finanzielle Zukunft. Inzwischen besitzen 45 Super-Reiche in Deutschland so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. 45 Menschen besitzen also genau so viel wie 40 Millionen weniger Wohlhabende.
Der französische Wirtschaftsforscher Thomas Piketty untersuchte 2014 die Einkommensentwicklungen der letzten 300 Jahre. Er fand zu allen Krisenzeiten eine Verarmung des Mittelstands, während die Oberschicht in jeder Krise durch höhere Gewinne ihrer Geldanlage reicher wurde. Diese Entdeckung ist auch in der Coronapandemie zu beobachten.

Profitiert von Covid-19: Amazon
Sinnbild dafür ist sicherlich der Amazon-Gründer Jeff Bezos. Seit Anfang des Jahres stieg sein Vermögen um mehr als 24 Milliarden US-Dollar auf umgerechnet über 126 Milliarden Euro. Währenddessen verlieren weltweit und grade in den USA Millionen von Menschen pandemiebedingt ihre Beschäftigung. Bezos‘ Angestellte arbeiten zum Mindestlohn, während Amazon mehr Umsatz als jedes andere Unternehmen generiert.
Sinkendes Rentenniveau
Die wohl wahrscheinlichste Folge der beschriebenen Entwicklung ist die Altersarmut. Schon im Jahr 2017 betrug die ausgezahlte Regelaltersrente im Durchschnitt nur 902 € monatlich. Zahlen die Rentner*innen davon ihre Miete, kommt es schnell zum Engpass. Die heute noch Berufstätigen müssen mit durchschnittlich noch weniger rechnen. Das liegt daran, dass in Deutschland junge Verdienende fehlen, die mit ihren Einzahlungen die Versorgung ihrer Großelterngeneration finanzieren. Die Bundesrepublik überaltert, was die Problematik noch verstärkt.
Dass in Europa Menschen mit ihrer Rente nicht über die Runden kommen und Studierende hohe Schulden aufnehmen, um dann nach dem Abschluss als Kassierer zu arbeiten während einige Wenige die Früchte des Ungleichgewichts ernten, das hat Folgen.
Einige Betroffene beginnen, an der Demokratie und am Sozialstaat zu zweifeln. Das Gefühl der ungerechten Behandlung führt immer mehr zu einer steigenden Unzufriedenheit mit dem Establishment. Menschen fühlen sich abgehängt und zurückgelassen. Grade in den letzten Jahren werden diese Menschen immer öfter von Rechtspopulisten abgeholt. Sie wettern gegen die „Eliten“ welche die einfachen Bürger*innen vernachlässige und schaffen es so, Zuspruch im Mittelstand zu finden, der jahrzehntelang das Kernklientel der Volksparteien bildete.
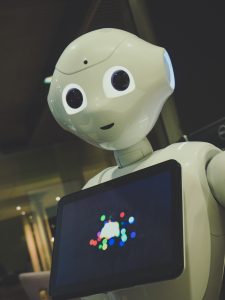
Die Zukunft?
Der digitale Todesstoß
Eine neu hinzukommende Herausforderung ist die Digitalisierung. Noch herrscht große Unsicherheit, wie sich digitale Technologie und künstliche Intelligenz auf Routinetätigkeiten auswirkt – sowohl ein Zuwachs als auch der Wegfall Hunderttausender Arbeitsstellen ist denkbar. Das vorherrschende Problem ist, dass die, die ihren Job im analogen Sektor einbüßen nicht auch gleichzeitig die sind, die die Jobs der digitalen Welt übernehmen können. Absteigen werden voraussichtlich ungelernte Arbeitskräfte, während Hochgebildete den Aufstieg meistern. Es braucht ein Umdenken, echte Veränderung, und zwar bald. Weiter die Augen zu verschließen wird Konsequenzen haben.
Chance auf Genesung
Doch wie geht es weiter? Wie schaffen wir es, unsere Kerngesellschaft vor dem wirtschaftlichen Aus zu bewahren? Ein Modell sieht vor, die Sozialabgaben nicht länger vom Gehalt der Arbeitnehmenden abzuziehen. Stattdessen würde von Unternehmen eine pauschale Sozialversicherungsabgabe verlangt werden, welche am Umsatz des jeweiligen Konzerns orientiert wäre. Folglich würde die Mittelschicht weniger zahlen und digitale Riesen, die kaum noch Menschen beschäftigen, aber Milliarden Umsätze generieren (Google, Facebook etc.), zahlen mehr und leisten einen Beitrag zur sozialen Absicherung. Als Nebeneffekt würde Arbeit billiger, ohne die Arbeitnehmenden zu belasten, was eventuell den Reiz von Neueinstellungen steigern würde.
Gleichzeitig sollte man schon jetzt in die Um- und Weiterbildung der Arbeitnehmenden investieren. Wenn Menschen erst einmal flächendeckenden von Maschinen und Algorithmen ersetzt wurden, ist es zu spät, sich zu wehren.
Die deutsche Mittelschicht stirbt. Die Symptome sind da, der Verlust ist für die Gesellschaft nicht tragbar. Aber: es gibt Hoffnung. Wir haben die Mittel, dem Kern unserer Gesellschaft zur Genesung zu verhelfen. Nutzen wir sie!
Fotos: Sharon McCutcheon, Christian Wiediger, Owen Beard – Unsplash